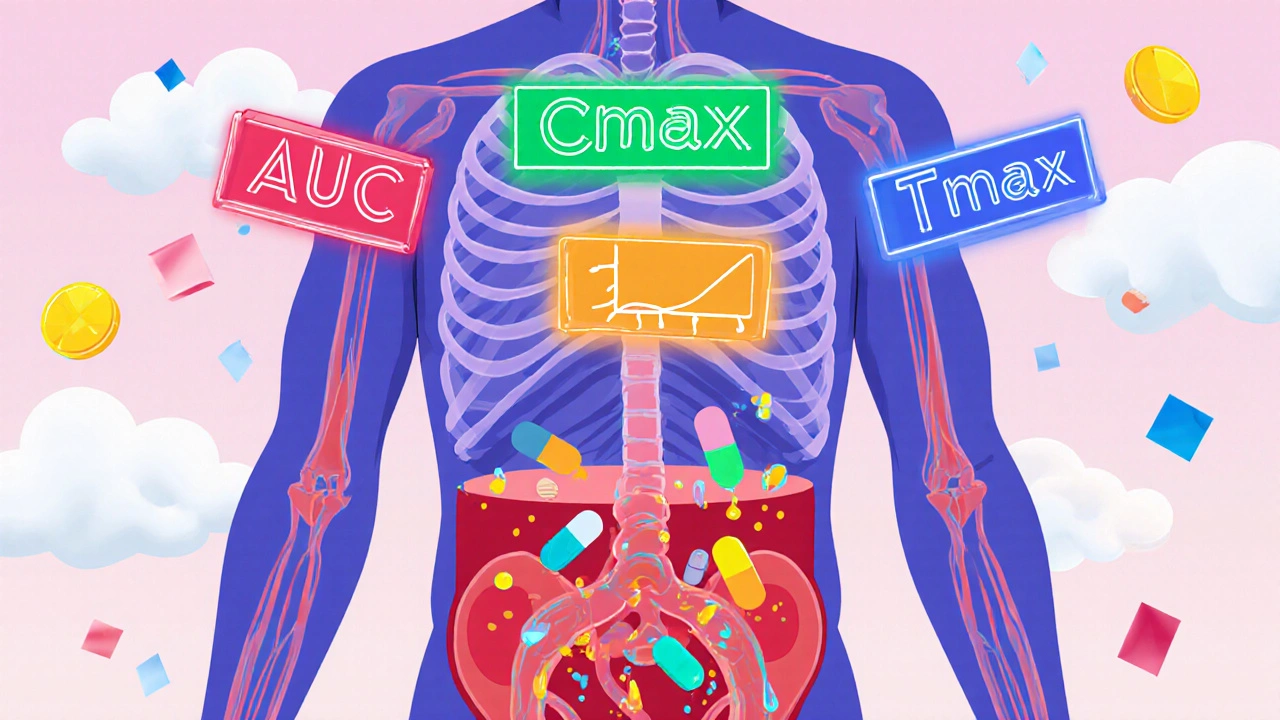Was genau wird bei Bioverfügbarkeitsstudien für Generika getestet?
Wenn ein Unternehmen ein Generikum auf den Markt bringen will, muss es nachweisen, dass es genauso wirkt wie das Originalmedikament. Doch wie kann man das messen, wenn man nicht jedes Mal mit Tausenden Patienten klinische Studien durchführen will? Die Antwort liegt in der Bioverfügbarkeit.
Bioverfügbarkeit beschreibt, wie schnell und wie viel von einem Wirkstoff nach der Einnahme in den Blutkreislauf gelangt und dort wirken kann. Es geht nicht darum, ob das Medikament im Körper wirkt - das ist klar. Es geht darum, ob es genauso wirkt wie das Original. Dafür messen Wissenschaftler drei entscheidende Werte: AUC, Cmax und Tmax.
AUC (Area Under the Curve) zeigt die gesamte Menge des Wirkstoffs an, die über die Zeit im Blut vorhanden ist. Es sagt also, wie viel vom Medikament aufgenommen wurde - die Größe der Wirkung. Cmax ist die höchste Konzentration, die im Blut erreicht wird. Das zeigt, wie schnell der Wirkstoff ins Blut gelangt - die Geschwindigkeit der Wirkung. Und Tmax gibt an, wann genau diese Höchstkonzentration erreicht wird. Diese drei Werte zusammen bilden das Fundament jeder Bioverfügbarkeitsstudie.
Die Messung geschieht durch wiederholte Blutabnahmen nach Einnahme des Medikaments. Dabei werden Blutproben über 24 bis 72 Stunden entnommen, je nach Halbwertszeit des Wirkstoffs. Die Konzentrationen werden mit hochgenauen Labormethoden bestimmt - und diese Methoden müssen streng validiert sein. Die Genauigkeit muss zwischen 85 und 115 % liegen, die Präzision darf nicht mehr als 15 % Abweichung haben. Nur so ist sichergestellt, dass die Ergebnisse verlässlich sind.
Warum reicht das aus? Die Bioäquivalenz-Annahme
Warum glaubt die FDA, dass diese Blutwerte ausreichen, um zu sagen: „Dieses Generikum ist genauso wirksam wie das Original“? Die Antwort ist die sogenannte Fundamental Bioequivalence Assumption: Wenn zwei Medikamente dieselbe Menge des Wirkstoffs im Blut erreichen und das mit derselben Geschwindigkeit, dann wirken sie auch klinisch gleich.
Diese Annahme ist nicht willkürlich. Sie basiert auf Jahrzehnten praktischer Erfahrung und Tausenden von Studien. Ein Wirkstoff, der im Blut gleich aufgenommen wird, wirkt auch in der Leber, im Gehirn oder im Herzen gleich. Das gilt für die meisten Medikamente - von Antibiotika über Blutdruckmittel bis hin zu Schmerzmitteln. Deshalb braucht ein Generikum nicht noch einmal zu beweisen, dass es bei Depressionen hilft oder den Blutzucker senkt. Es muss nur zeigen: Ich komme genauso schnell und genauso viel ins Blut wie das Original.
Die FDA hat diese Regel 1984 mit dem Hatch-Waxman Act festgelegt. Seitdem können Generika schneller, günstiger und sicher zugelassen werden - ohne dass Patienten auf Wirksamkeit verzichten müssen. Heute werden in den USA 97 % aller Rezepte mit Generika abgegeben. Das ist kein Zufall. Das ist das Ergebnis eines robusten wissenschaftlichen Ansatzes.
Wie wird Bioäquivalenz mathematisch bewiesen?
Es reicht nicht, einfach zu sagen: „Unser Generikum hat 95 % der AUC des Originals.“ Die FDA verlangt eine strenge statistische Prüfung. Die Werte von AUC und Cmax des Generikums werden mit denen des Originals verglichen. Dann berechnet man das Verhältnis der geometrischen Mittelwerte - also den Durchschnitt der Vergleichswerte.
Die Zulassung erfolgt nur, wenn der 90 %-Konfidenzintervall dieses Verhältnisses zwischen 80 % und 125 % liegt. Das bedeutet: Selbst unter Berücksichtigung aller Messunsicherheiten, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Generikum nicht mehr als 20 % weniger oder 25 % mehr Wirkstoff ins Blut bringt als das Original.
Warum genau diese Grenzen? Weil Forscher festgestellt haben: Ein Unterschied von 20 % in der Bioverfügbarkeit ist für die meisten Medikamente klinisch irrelevant. Ein Patient merkt nicht, ob er 90 % oder 110 % des Wirkstoffs bekommt - solange er stabil bleibt. Diese Grenzen sind nicht willkürlich festgelegt. Sie basieren auf klinischen Daten und Erfahrungswerten aus Jahrzehnten.
Es gibt aber Ausnahmen. Bei Medikamenten mit engem Wirkungsspektrum - wie Warfarin, Digoxin oder Levothyroxin - ist die Toleranz kleiner. Hier gilt ein Bereich von 90 % bis 111 %. Denn hier kann ein kleiner Unterschied zu schwerwiegenden Folgen führen: zu viel Warfarin = Blutung, zu wenig = Thrombose. Deshalb werden diese Medikamente besonders streng geprüft.

Wie läuft eine Bioäquivalenzstudie ab?
Die meisten Studien folgen einem standardisierten Design: eine zweiphasige, zweigruppige Kreuzungsstudie. Das heißt: 24 bis 36 gesunde Freiwillige nehmen zunächst das Generikum ein, dann nach einer Wartezeit von mindestens fünf Halbwertszeiten - damit kein Rückstand mehr im Körper ist - das Originalmedikament. Oder umgekehrt. Die Reihenfolge wird zufällig vergeben, damit keine Verzerrung entsteht.
Die Studie dauert mehrere Wochen. Die Teilnehmer essen zur gleichen Zeit, trinken nur Wasser, und liegen ruhig. Jede Blutabnahme erfolgt genau zum festgelegten Zeitpunkt - oft 12 bis 18 Mal pro Phase. Die Proben werden sofort gekühlt, analysiert und dokumentiert. Jeder Schritt ist protokolliert, damit alles reproduzierbar ist.
Ein Beispiel: Ein Generikum zeigt eine AUC von 38, das Original von 42. Das Verhältnis ist 0,90 - also 90 %. Das liegt im Bereich. Aber wenn die AUC des Generikums 29 beträgt und des Originals 25, ist das Verhältnis 1,16 - 116 %. Klingt gut? Nicht wenn das 90 %-Konfidenzintervall bis 130 % reicht. Dann ist das Generikum abgelehnt, weil die Wahrscheinlichkeit zu hoch ist, dass es in einigen Patienten zu viel Wirkstoff freisetzt.
Wann kann man auf Studien verzichten?
Nicht jedes Generikum muss mit einer klinischen Studie bewiesen werden. Die FDA erlaubt Ausnahmen - besonders für einfache, gut verstandene Wirkstoffe. Das funktioniert über das Biopharmaceutics Classification System (BCS).
BCS-Klasse 1: Wirkstoffe mit hoher Löslichkeit und hoher Durchlässigkeit. Wenn das Generikum die gleiche Zusammensetzung hat wie das Original und sich in der gleichen Zeit auflöst, kann die Bioäquivalenz durch in vitro-Tests nachgewiesen werden - also im Labor, nicht am Menschen. Das spart Zeit und Geld. Beispiele: Paracetamol, Metoprolol.
BCS-Klasse 3: Wirkstoffe mit hoher Löslichkeit, aber geringer Durchlässigkeit. Auch hier kann ein Verzicht auf klinische Studien möglich sein - wenn die Formulierung nahezu identisch ist und sehr schnell aufgelöst wird. Das gilt für viele Antibiotika wie Amoxicillin.
Die FDA hat diese Regelungen seit 2023 noch erweitert. Mit neuen Modellen und künstlicher Intelligenz kann heute vorhergesagt werden, ob ein Generikum bioäquivalent ist - ohne dass eine Studie nötig ist. Ein Projekt mit dem MIT hat 87 % Genauigkeit bei der Vorhersage von AUC-Werten erreicht. Das ist ein großer Schritt in Richtung effizienterer Zulassung.
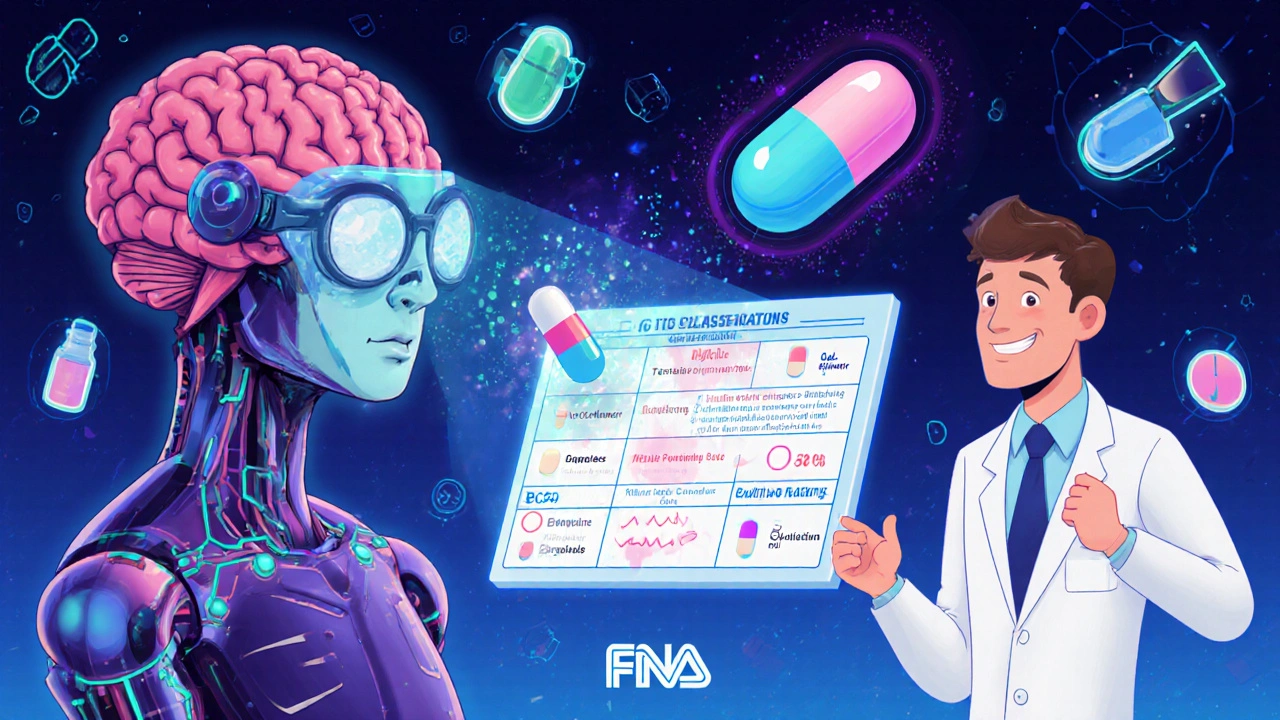
Was ist mit komplexen Generika?
Es gibt Medikamente, die nicht einfach zu kopieren sind. Inhalatoren, Gels, langwirkende Tabletten, biologische Wirkstoffe - sie haben komplexe Freisetzungsmechanismen. Hier reicht ein einfacher AUC-Vergleich nicht aus.
Bei einem langwirkenden Schmerzmittel muss man nicht nur die Gesamtmenge im Blut messen, sondern auch, wie der Wirkstoff über 12 oder 24 Stunden freigesetzt wird. Dafür werden mehrere Zeitpunkte analysiert - nicht nur Cmax und AUC, sondern auch AUC für bestimmte Zeitintervalle. Bei topischen Cremes, wie Cortison-Salben, misst man nicht das Blut, sondern die Wirkung auf die Haut - etwa die Verengung der Blutgefäße.
Und bei Wirkstoffen mit sehr hoher Variabilität - wie Tacrolimus - ändert sich die Regel: Wenn der Wirkstoff im Körper stark schwankt, wird der Akzeptanzbereich angepasst. Statt 80-125 % kann er auf 75-133 % erweitert werden. Das nennt man „scaled average bioequivalence“ (RSABE). Diese Methode wurde 2021 bei einem Tacrolimus-Generikum erstmals erfolgreich angewendet.
Stimmt es, dass Generika manchmal nicht gleich wirken?
Einige Patienten berichten: Nach dem Wechsel zu einem Generikum habe ich Kopfschmerzen, Schwindel, oder meine Epilepsie ist schlechter geworden. Das ist beunruhigend - und es gibt Fälle, in denen das zutrifft.
Aber: Die Zahlen zeigen, dass es extrem selten ist. Die Epilepsie-Stiftung hat zwischen 2020 und 2023 187 Berichte gesammelt. Nur 12 davon - also 6,4 % - wurden von der FDA als möglicherweise auf Bioäquivalenzprobleme zurückzuführen eingestuft. Der Rest lag an falscher Einnahme, Wechselwirkungen oder Krankheitsverlauf.
Ein Kardiologe berichtete von drei Patienten, bei denen der Wechsel von Amlodipin-Original zu Generikum zu Herzrasen führte. Das klingt viel - aber bei 3.000 Patienten sind das 0,1 %. Und alle Symptome verschwanden, als er wieder zum Original wechselte.
Die Wissenschaft sagt: Für die überwiegende Mehrheit der Medikamente funktioniert Bioäquivalenz hervorragend. Die FDA hat seit 1984 über 15.000 Generika zugelassen. Es gibt keine dokumentierten Fälle, in denen ein Generikum wegen zu strenger Bioäquivalenz-Grenzen klinisch versagt hat - außer bei diesen seltenen Ausnahmen.
Der Grund: Die 80-125 %-Grenze ist kein „Schlupfloch“. Sie ist eine Sicherheitszone. Sie stellt sicher, dass das Generikum nicht zu schwach oder zu stark wirkt. Und wenn es trotzdem Probleme gibt - dann liegt es nicht an der Regel, sondern an der Komplexität des Medikaments. Und dafür arbeiten die Behörden mit neuen Methoden daran, die Lücken zu schließen.
Was kommt als Nächstes?
Die Zukunft der Bioäquivalenz ist digital. Die FDA forscht an Modellen, die aus der Zusammensetzung eines Wirkstoffs und seiner Formulierung vorhersagen können, ob er bioäquivalent ist - ohne eine Studie am Menschen. Künstliche Intelligenz analysiert Tausende von Datenpunkten: Partikelgröße, Löslichkeit, pH-Wert, Stabilität - und sagt: „Das wird funktionieren.“
Die Industrie entwickelt neue Analysemethoden, die weniger Blutabnahmen brauchen. Und die Regulierungsbehörden in Europa, USA und Japan arbeiten enger zusammen. 95 % der einfachen oralen Medikamente werden heute mit denselben Regeln zugelassen - weltweit.
Was bleibt? Die Erkenntnis: Bioäquivalenzstudien sind nicht perfekt - aber sie sind die beste Methode, die wir haben. Sie machen Generika sicher, erschwinglich und breit verfügbar. Und sie retten jedes Jahr Millionen von Menschen das Leben - durch günstigere Medikamente, die genauso wirken wie die teuren Originalprodukte.